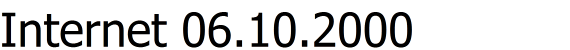Vereinte Völker von Ludwigsfeld
Im Nordwesten von München liegt ein kleiner Ort, in dem Fremde sich wie zu Hause fühlen:
Feinkost »Schlaraffenland« in Ludwigsfeld, geführt von Natascha, Tochter eines Palästinensers
und einer Ukrainerin, und Jorgo, dem Griechen
VON CHRISTIAN SCHÜLE
Sie nennen Ludwigsfeld ihre Heimat, obwohl sie alle aus der Fremde kamen.
Der Ort, der einst ein SS-Arbeitslager war, ist heute ein Mikrokosmos, in dem Menschen aus vielen Völkern einträchtig zusammenleben
Der Freitagabend im "Kastaniengarten" war schon etwas vorgerückt, als dem Kalmücken Dschirgl Delekajev, während zwei Aserbaidschaner zu türkischer Musik tanzten wie Orientgrazien, die Tränen in die Augen rannen. Er nahm die Brille ab und ließ sich umarmen von Olli Krmadjian, dem Armenier mit thüringischer Mutter. Es flossen noch mehr Tränen an diesem Abend, innere und äußere. Nico Romanow, Sohn eines Kalmücken und einer jugoslawischen Mutter, weinte Tränen eines Mannes, der 1956 mit neunzehn nach Chicago auswanderte und nach über vierzig Jahren zurückkehrte, nach Ludwigsfeld, dorthin, wo das war, was er "sein Leben" nennt.
Wenig später kam noch Mischa hinzu, der russische Atomphysiker, der wunderbar Klavier spielen kann, und Vladimir Jalowetz, der große, blonde West-Ukrainer, der sonst ein ruhiger Mensch ist und an diesem Freitagabend, als dieser allmählich zur Nacht wurde, so herrlich betrunken war. Dschirgl hielt alle Szenen, die sich ereigneten, mit dem Fotoapparat fest. Auf dem Tisch der Kneipe standen Weißbier und Tee, Börek und frittierte Zucchini; der Koch im "Kastaniengarten" ist Türke, sein Kellner Kurde.
Der Kalmücke Dschirgl Delekajev war zu Besuch aus Amerika gekommen. Ja, so war es, er war wieder nach Hause gekommen, für eine zu kurze Woche Herzlichkeit. Einst war er fortgegangen, um Berufssoldat zu werden, war in Vietnam und Korea, wurde verwundet und trug in sich stets eine viel größere Wunde: die Wunde der Sehnsucht. Und jetzt ist er hier zu Besuch in der kleinen, nicht über die Maßen schönen Siedlung Ludwigsfeld im Nordwesten von München, für ihn mehr als die Welt. 300 auf 300 Meter groß ist das Stück Erde, das der Kalmücke Dschirgl ewig lieben wird, weil hier nie etwas anderes zählte als das reine Menschsein. Hier waren alle gleich. Alle galten gleich viel, egal woher sie kamen, woran sie glaubten, wie sie aussahen.
Weinranken klettern manche Plattenbaublocks hinauf, an manch anderen hängen Balkone. Unterscheidbar sind die 32 Blöcke nur an ihren Nummern. Fast überall sind die Türen offen, Fahrräder stehen in Ständern davor, Wäsche hängt über der Leine, und in den Vorgärten von ein mal drei Metern sind Hibiskus, Rosen und Farn gepflanzt. Sehr akkurat, fast deutsch.
Da gibt es den Maibaum, das Begegnungszentrum, das Rollschuhfeld, den Fußballplatz. Der Abendwind weht die herbstlich gelbgrünen Blätter über den Onyxplatz, und sie bleiben vor dem Feinkostladen von Giuseppe Virruso liegen. Averna, Grappa, Ramazotti hat er im Schaufenster; in den Regalen stehen viele Päckchen Farfalle und Tagliatelle, daneben liegen Sellerie, Porree und rote Zwiebeln. Seit neuestem verkauft Giuseppe auch Briefmarken und Telefonkarten.
Neben Virruso bietet Anatolij Kiritschenko "Tabak, Getränkedienst, Blumen" an. Das letzte Geschäft am Onyxplatz und in Ludwigsfeld ist der Feinkostladen "Schlaraffenland". Es wird geführt von Natascha, Tochter eines Palästinensers und einer Ukrainerin, und von Jorgo, ihrem Mann, dem Griechen.
Der traurige Teil der Geschichte Ludwigsfelds endete, als im April 1945 die Amerikaner kamen. In Holz- und Steinbaracken, einst Pferdeställe, lagen ausgemergelte Menschen - und Leichen. Es waren die Letzten der Tausende, die über die Zeit Fleckfieber, Typhus, Tuberkulose oder die Misshandlungen der Wachmannschaften und Offiziere hinweggerafft hatten. Die Siedlung Ludwigsfeld war von 1943 bis 1945 ein SS-Arbeitslager, das Außenlager Allach 1 des KZ Dachau. Als die Amerikaner kamen, lebten von 22000 Inhaftierten noch 8970 Männer und 1027 Frauen, 300 Menschen in einer Baracke, Zwangsarbeiter, die für die Bayerischen Motoren Werke arbeiteten, deren Fabrikhallen vis-à-vis standen.
Nach der Befreiung folgten den Zwangsarbeitern Kriegsgefangene und Flüchtlinge und dann kamen die nach Ludwigsfeld, die heimatlos waren. Es waren Menschen, die aus dem Osten zwangsverschleppt waren und die das Bild von Ludwigsfeld prägten, wie es bis heute typisch ist für den kleinen Ort zwischen München und Dachau, wo heute 1000 Menschen die vererbten Ideale einer einzigartigen Schicksalsgemeinschaft leben.
Er hat hochgeschnittene Jochbeine, dunkelroten Teint und er lacht herzlich, so dass die schmalen Augen zum Strich werden. Geboren wurde er 1923 in der Salzsteppe Rußlands. Er ist Donkosake, Kalmücke. Er heißt Boris Kuberlinow. 1929 verlor er seine Eltern. Sein Vater war Hauptmann der Donkosaken im Garderegiment des Zaren. Stalin ließ ihn erschießen. Stalin ließ auch seine Mutter erschießen. Boris, Sohn eines "Volksfeindes", ging zu Verwandten, die deshalb später nach Sibirien verschleppt wurden. 1943 wurde er mit 200 Kalmücken, Kaukasiern, Russen von der Straße aufgelesen und in einen Güterwaggon gepfercht, Richtung "Deutsches Reich". Boris wurde Zwangsarbeiter eines österreichischen Bauern.
Als die Rote Armee schon vor Breslau lag, meldete er sich aus Angst freiwillig zur Wehrmacht, wo es eine Kosakeneinheit gab. Auf Irrwegen kam er nach dem Krieg schließlich ins Lager Schleißheim, wo er Margareth aus Jena traf, die er heiratete. Und er traf Nico Romanow und Dschirgl Delekajev, Milan Sovic, Hans Thiel, Anusch und Olli Krmadjian. All jene, mit denen Boris Kuberlinow ab 1952 die Vereinten Nationen von Ludwigsfeld begründete und damit den Himmel neu erfand.
Sie waren Heimatlose, Ausländer mit deutschem Pass und ohne Wahlrecht, und ihr Zusammenleben war erst ein großes Wagnis, denn Polen hassten Großukrainer und die wiederum die Russen, und manche Balten hielten sich für Besseres und verschmähten Slawen und Turkvölker. Viele der oststämmigen Zwangsarbeiter und Flüchtlinge, die der Krieg noch lebend ausspuckte, waren krank und durften nicht in die USA oder nach Neuseeland auswandern, manche waren gesund und wollten es nicht. Sie hatten alles verloren, aber sie hatten sich. Sie waren Opfer der gleichen Tragödie, des gleichen Wahns, der gleichen Entwürdigung, und deshalb wurde die Siedlung Ludwigsfeld für sie zum Paradies, was keiner ahnen konnte. Und dann bekamen sie von der Caritas zu Weihnachten Töpfe und Geschirr, bekamen Zuversicht und begannen freiwillig zu arbeiten.
Am Samstagabend spielt DJ Olli Krmadjian, der Armenier, der so lange Theaterleiter war und Sozialarbeiter, Olli also spielt in der "Ludwigsfelder Einkehr", der alten SS- Mannschaftskantine in der letzten existenten Originalbaracke, den ollen Neil Sedaka und dann Eddie Cochran, und die polnische Witwe Johanna twistet mit dem waschechten Russen Vitali neben Napsu, der groß gewachsenen Kalmückin, die den bayerischen Kalmücken Gaga Iwanow umtänzelt, dass es eine Freude ist. Nico Romanow wiegt die Hüften und filmt das Glück ohne Unterlass.
Es ist die spontane Abschiedsparty für Dschirgl, der zurück in die USA muss, und es blüht die übliche, legendäre Ludwigsfelder Ausgelassenheit. Niemanden interessiert es, wer man ist oder was man hat. Das war immer so in Ludwigsfeld. Keiner brauchte angeben. Niemand hatte mehr. Die "Wohnlöcher" waren alle gleich, und die Schönheit lag ohnehin innen. Die Türen standen immer offen, die Fenster auch. Man hörte ukrainische und russische Musik, armenische und baltische. Man roch gekochte Kalbsköpfe, roch Hammel, sah ukrainische und kalmückische Volkstänze, erlebte russisch-orthodoxe Hochzeiten, armenisch- gregorianische Taufen, aserbaidschanische Beschneidungsfeste, lettische Johannisfeuer.
Und bis 1961 waren alle Grundsatzkonflikte bereinigt, waren Ressentiments offen gelegt und besprochen, da gab es keine Schießereien, Messerstechereien mehr, nur ab und an Prügeleien, bis sie alle Wodka tranken und sich wieder in den Armen lagen. All die menschlichen Probleme, sagen die Ludwigsfelder, wurden im Schnelldurchlauf erlebt und gelöst, in der manchmal klammen Enge und unerträglichen Nähe dieser Siedlung, die wie ein Ghetto war, isoliert und abgeschieden vom Rest Deutschlands. Sie rauften sich zusammen, weil sie es mussten, und 1969 machte in Ludwigsfeld sogar die Polizeidienststelle zu.
Als die neuen 640 Ludwigsfelder Wohneinheiten mit Marshallplangeld dort gebaut waren, wo gerade noch die Holz- und Steinbaracken des SS-Zwangsarbeiterlagers standen, zogen die Heimatlosen in Ein-, Zwei-, oder Dreizimmerwohnungen. Es gab kein Bad und keine Heizung. Es war kalt. Es herrschte Öde. Es blieb die Fremde. Und nebenan zogen Deutsche ein, von denen man wusste, dass sie Nazis waren, dass sie im Außenlager Allach 1 Dienst getan hatten, Tür an Tür lebte man zusammen, und irgendwann kam man ins Gespräch, und dann flossen auch Tränen der Reue. 2025 heimatlose Ausländer und 873 Volksdeutsche zogen ab Dezember 1952 in die Wohnungen, die noch heute dem Bundesvermögensamt gehören. Das Gelände war kahl. Es gab keine Geschäfte, keine Straßen, keine Bordsteine.
Diese neue Welt aber füllten Armenier, Aserbaidschaner, Belorussen, Bessarabier, Bosnaken, Bulgaren, Esten, Georgier, Griechen, Kalmücken, Karakalpachen, Kirgisen, Kroaten, Letten, Litauer, Osseten, Polen, Rumänen, Russen, Serben, Slowaken, Tataren, Tschechen, Turkmenistaner, Ukrainer, Ungarn und Usbeken. Es lebten hier die heimatvertriebenen Volksdeutschen aus dem Banat, der Batschka, aus Ostpreußen, Pommern, Schlesien, Siebenbürgen, dem Sudetenland und von der Wolga. Es vereinten sich 22 Nationalitäten und dreizehn Religionsgemeinschaften zu einer unverhofften und gelebten Utopie.
Ja, es stimmt, manche gingen weg, nach England, in die USA, aber die meisten kamen wieder, und ihre Kinder mieteten sich hier ein und die Kindeskinder, kaum einer der dritten Generation will heute gehen, und sie alle, die Alten, die einst ihre Heimat verloren, sie hörten nicht auf, von Heimat zu reden, und wenn sie heute Heimat sagen, dann sagen sie immer nur: Ludwigsfeld.
Die Rubinstraße ist nicht besonders lang., Im Haus Nummer 14 wohnen die Kuberlinows. Boris hat den Schlüssel zum buddhistischen Tempel Ludwigsfelds. Der befindet sich im Nebenhaus und ist ein mit wertvollen Seidengemälden geschmücktes Ludwigsfelder Wohnzimmer. Drei aus Holz selbst gefertigte Throne stehen hier, auf dem Steinaltar sind Kerzen und im Schrein eine Buddha-Statue. Man riecht kalten Weihrauch. Lange Jahre zelebrierte hier ein kalmückischer Lama den Gottesdienst an den Feiertagen, zum Jahreswechsel, zu Halb- und Vollmond, dann wurde es ein tibetischer, und zweimal war Seine Heiligkeit, der Dalai-Lama, schon zu Besuch. Herr Kuberlinow selbst geht jede Woche beten. In der Russisch-orthodoxen und der Ukrainisch-orthodoxen Kirche halten sie Messen in russisch und ukrainisch ab, die Polen feiern in der katholischen, die Protestanten in der evangelischen Kirche. Manchmal feierten in Ludwigsfeld die Religionen auch zusammen ihre verschiedenen Neujahre, und die Kinder der siedlungseigenen Schule hatten gleich an mehreren Tagen frei, das war eine Freude. Toleranz galt stets als Seele des Seins.
"Das ist meine Heimat", sagt Margareth Kuberlinow, "meine Heimat seit 48 Jahren", und ungefragt treten ihr Tränen in die Augen, "ach, meine Heimat", sagt Nico Romanow, der mit 19 nach Chicago ging, "diese großartige Jugend", er entschuldigt seine Rührung, "so eine Gemeinde gibt es nicht noch einmal." Alle sagen sie das Gleiche, und nichts deutet an diesem föhnmilden Abend, als in der "Einkehr" die vereinten Völker zum "Calender girl" singen und schwofen, darauf hin, dass sich hier je etwas ändern wird.
|